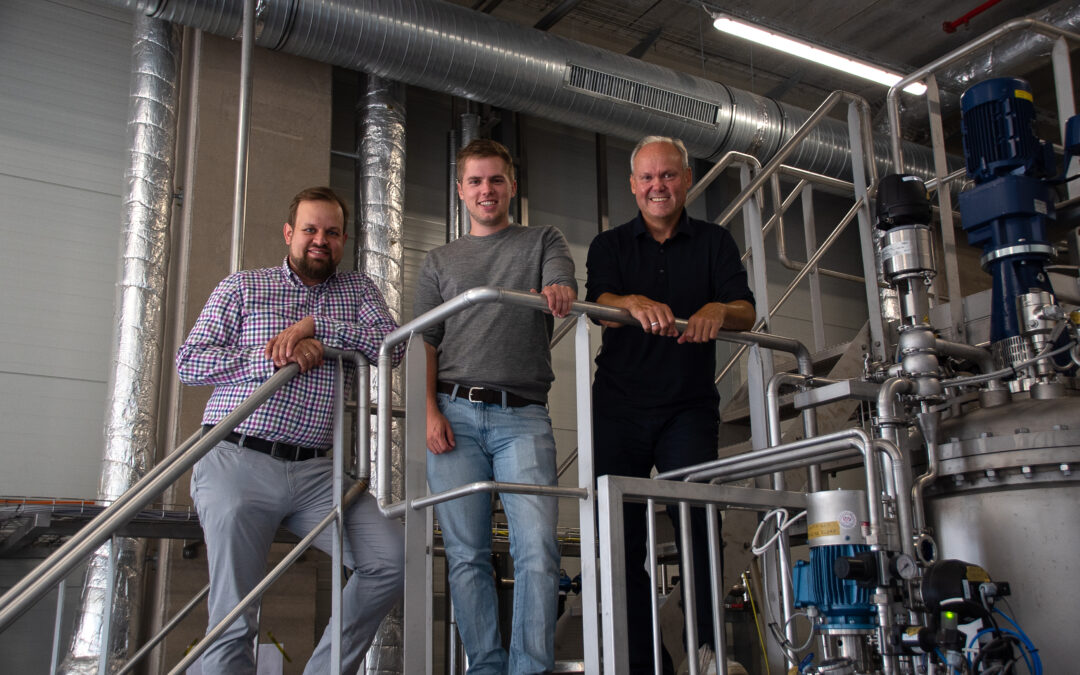Bild: Eat Beer
Eat-Beer-CTO Mark Schneeberger über Zirkularität, Künstliche Intelligenz und Daten in der Produktentwicklung, sowie die Rolle der Verbrauchenden für die Entwicklung eines resilienten Lebensmittelmarkts rund um alternative Proteine.
Ihr arbeitet an einem Fermentationsprodukt. Worum handelt es sich dabei?
Mark Schneeberger: Wir wollen von der linearen Produktion wegkommen und hin zur Zirkularität. Take, make, waste war gestern. Reststoffe müssen wieder nutzbar gemacht werden. Deshalb konzentrieren wir uns auf Treber aus dem Braubetrieb und wollen sie am Ort der Entstehung über eine modulare, containerbasierte Lösung aufarbeiten. Mithilfe der Biomassefermentation erzeugen wir Mykoprotein, das als Lebensmittelinhaltsstoff dient. Ich kann verschiedene Arten von Mikroorganismen für die Weiterverarbeitung nutzen. Pilze sind nur eine Möglichkeit. Mit Milchsäurebakterien könnte ich beispielsweise auch Biopolymere herstellen. Das ist eine Option, unseren Ansatz der Zirkularität abseits der Proteinbranche schneller zu monetarisieren, da wir den Novel-Food-Prozess durchlaufen müssen. Derzeit sind wir mit der EFSA aber im Austausch, ob wir den Prozess abkürzen oder in eine alternative Zulassungsroute gehen können.
Um dann Bioreaktoren zu den Brauern zu bringen?
Mark Schneeberger: Wir nutzen keine hochskalierten Fermentationseinheiten und Tanks mit 150 bis 200 Kubikmeter, sondern verfolgen einen “Designed-to-use-Ansatz”. Dieses Vorgehen kommt aus dem Automotive-Bereich und dem Flugzeugbau, wo es um komplexe Einheiten geht und vor dem Einsatz alles an der Maschinerie stimmen muss. Die Engineering-Kompetenzen holen wir demnach weit nach vorne bei der Entwicklung und minimieren damit Fehler. Digitalisierung spielt hier eine große Rolle, um die Prozesse möglichst transparent zu machen und kontinuierlich zu lernen. Alles, was an Daten erfasst werden kann, wird erfasst. Ob direkt oder über Sensorik. Egal, wo ein Reaktor am Ende auf der Welt steht, wir behalten immer den Überblick darüber, was gerade in den Anlagen passiert.
Wie dürfen wir uns die Prozessentwicklung dafür vorstellen?
Mark Schneeberger: Am einfachsten ist es, wenn ich den Reststoff aus der Brauerei nehme und die Pilze einfach machen lasse. Das dauert aber sehr lange. Ich könnte natürlich anstatt zwei einfach 20 Einheiten produzieren, dann wird der Business Case aber irgendwann wackelig, weil die Erstinvestition so groß ist, dass der Return unattraktiv wird. Wir müssen die Treber also einer Vorbehandlung unterziehen, um die darin vorhandenen Makromoleküle für den Pilz “gefügiger” zu machen. Dadurch verändere ich Prozesszeiten, aber auch das Profil. Bei diesem Vorgehen hilft uns die KI von einem weiteren deutschen Start-up, das eine Plattform speziell für Restströme entwickelt hat. Sie füttern ihre Datenbanken und Modelle mit meinen Anforderungen und ich erhalte eine Strategie mit verschiedenen Technologien, die auf dem Readiness-Level getestet sind. So fange ich nicht immer bei 0 an.
Ihr würdet die Treber gefügiger machen. Was bedeutet das?
Mark Schneeberger: Im Kern geht es um Gerstenmalz. Brauer extrahieren daraus die Stärke, die in vergärbare Zucker umgewandelt wird. Übrig bleibt Treber mit Makromolekülen wie Zellulose. Das sind Monstermoleküle, mit denen Mikroorganismen zunächst Schwierigkeiten haben. Wir setzen deshalb Prozesse ein, um diese Strukturen sukzessive zu verkleinern, sodass die Mikroorganismen sie – ob Pilze oder Bakterien – deutlich leichter verwerten können. Dabei stehen unterschiedliche technologische Ansätze zur Verfügung. Im Lebensmittelbereich wollen wir jedoch keine unnötige Komplexität einführen, sondern möglichst natürliche Verfahren nutzen. Hier gilt es darum, den goldenen Mittelweg zu finden.
Wie weit seid ihr mit dieser Entwicklung?
Mark Schneeberger: Die Erprobung unseres Mikroorganismus hat bisher auf universitärer Ebene stattgefunden. Jetzt geht es darum, den nächsten Schritt zu machen. In Stralsund ist dafür eine erste Demoanlage mit zwei Fermentern als Schlüsselelementen in Betrieb gegangen. Mittelfristig wollen wir zudem bei unserem Partner Störtebeker eine größere Pilotanlage installieren, um weitere Erfahrungen im Scale-up zu sammeln. Dabei spielt die Digitalisierung eine zentrale Rolle: Auch wenn die Bierproduktion ein traditionsreicher Prozess ist, bleibt es unumgänglich, Proben zu analysieren und Daten zu erheben. Ziel ist es jedoch, Prozesse zunehmend zu simulieren und die gesammelten Daten intelligent zu verknüpfen. Da wir über tausende Werte sprechen, unterstützt uns KI dabei, komplexe Muster zu erkennen und daraus gezielt Prozessstrategien abzuleiten – die Entscheidungen bleiben dabei selbstverständlich immer bei uns. Auf dieser Basis entwickeln wir die containerbasierte Modellierung und das Reaktordesign, in enger Zusammenarbeit mit universitären Partnern.
Und der Bedarf bei den Brauern, die Treber auf diese Weise in den Kreislauf zu bringen, ist da?
Mark Schneeberger: Ich war sehr lange bei einem großen deutschen Anlagenbauer als Entwicklungsleiter tätig. In dieser Funktion habe ich mit verschiedenen Braugruppen gesprochen, die über Jahrzehnte Partnerschaften aufgebaut haben. Wenn sie Partnern wie Landwirtschaftlichen, die die Treber als Tierfutter einsetzen, plötzlich mitteilen, ab morgen bekommt ihr übrigens keine Treber mehr, ist das geschäftsschädigend. Wir können nicht von jetzt auf gleich alles anders machen, sondern müssen in den Dialog mit allen Stakeholdern. Das zu schaffen, ist ein zentrales Thema. Da die Nachfrage nach Tierfutter perspektivisch zurückgehen könnte, braucht es alternative Verwertungswege.
Welche Rolle spielt Treber wirtschaftlich derzeit für Brauer?
Mark Schneeberger: Derzeit liegt der Preis für eine Tonne Treber bei rund 30 €. Der Marktwert für Proteine ist dagegen um ein Vielfaches höher. Perspektivisch eröffnet das auch für Brauereien wirtschaftliche Chancen, wenn neue Verwertungswege erschlossen werden. Insgesamt soll unser Protein langfristig unter dem durchschnittlichen Preis ähnlicher Produkte liegen. Der ist immer noch so hoch, dass selbst der skeptische Brauer irgendwann anfängt zu rechnen. Dabei gehen wir auch in den Dialog, um die Bedürfnisse der Brauer in Erfahrung zu bringen. Wir wollen beispielsweise wissen, ob sie die Treber verkaufen wollen oder etwa Teil des Modells sein wollen und wir ein Lizenzgeschäft anbieten. Aber in erster Linie geht es zunächst darum, die Treber abzukaufen und zu prozessieren.
Um am Ende ein Isolat zu vermarkten?
Mark Schneeberger: Genau. Wir stehen bereits mit Unternehmen aus der Weiterverarbeitung im Austausch – sowohl mit großen Playern als auch mit regionalen Herstellern. Daraus gewinnen wir wertvolle Einblicke in die Anforderungen der Industrie und können den konkreten Bedarf besser einschätzen. Dieser Dialog ist für uns zentral, denn nur so lässt sich klären, wie unsere Produkte sinnvoll in bestehende Wertschöpfungsketten integriert werden können. Hier spielt auch die Politik eine wichtige Rolle, um die Rahmenbedingungen für solche Innovationen zu unterstützen.
Inwiefern?
Mark Schneeberger: Förderung ist eines der zentralen Themen. Es braucht Anreize für Investitionen. Wir müssen wie zahlreiche andere Player auch noch viel Energie und Wissen in unsere Entwicklung stecken, da kommen wir an Förderungen nicht vorbei. Die Förderlandschaft ist aber unfassbar komplex, was uns ausbremst. Wir nehmen derzeit an einem EU-Projekt teil, bei dem ich die Plattform auf Englisch bedienen muss. Da es ein Kooperationsprojekt zwischen Deutschland und Israel ist, muss ich das Ganze aus der deutschen Perspektive für Deutschland darlegen. Dann alles noch einmal auf Englisch und immer nach den jeweiligen Regularien. Und dann noch einmal auf israelischer Seite. Diese Prozesse müssen einfacher werden.
Finanziert ihr euch komplett über solche Förderungen?
Mark Schneeberger: Unser aktuelles Förderprogramm läuft im August aus. Deshalb arbeiten wir bereits am nächsten großen Projektantrag in Mecklenburg-Vorpommern. Der Standort bringt für uns besondere Herausforderungen mit sich, da es hier bislang noch wenig etablierte Strukturen im Bereich Biotechnologie gibt. Gleichzeitig eröffnet das aber auch Chancen, neue Netzwerke zu schaffen. Da wir als Start-up eng mit Störtebeker verbunden sind, gelten wir formal als verbundenes Unternehmen und sind deshalb darauf angewiesen, mit kleineren Partnern zu kooperieren. Genau darin liegt für uns auch eine Stärke: Gemeinsam mit regionalen Unternehmen können wir neue Partnerschaften aufbauen und stabilisieren. Darüber hinaus schauen wir uns ergänzend nach überregionalen Förderprogrammen um, um unsere Entwicklung weiter voranzubringen.
Einzelne Länder müssen sich also strukturell weiterentwickeln, um wirtschaftlich zu werden?
Mark Schneeberger: Es ist unsere ökonomische Verantwortung, zu evaluieren und zu agieren, um einen resilienten Markt zu etablieren und wäre zu einfach, zu sagen “die Politik muss aber”. Wir sollten uns also immer auch fragen, was wir für uns selbst tun können, um von Anfang an die richtigen Fragen zu stellen und wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und da komme ich immer wieder beim Thema Verbraucherakzeptanz an. Wir können die besten Produkte der Welt herstellen. Wenn der Verbraucher nicht versteht, was wir künftig auf unseren Tellern haben wollen, kommen wir nicht weiter. Ein Ansatz in dieser Diskussion sind Labels. Die Produkte unserer Branche sind zunächst einmal erklärungsbedürftig. Wir müssen sie von Anfang an ins rechte Licht rücken, Teil der Diskussion sein und Transparenz in die Prozesse bringen.
Sollte es dafür Reallabore geben?
Mark Schneeberger: Reallabore sind ein wichtiger Schritt. Wir haben bei Störtebäcker den Luxus, dass wir auf zahlreiche Köche zurückgreifen können, um die Produkte zu testen. Gleichzeitig haben wir eine Forschungseinrichtung in Neubrandenburg, in der wir auch Zugriff auf die Küche und deren Sensorikeinrichtung haben. Die sind aber nicht offen für jeden. Wir müssen die Menschen an die Hand nehmen. Das ist ein zentraler Erfolgsfaktor, den wir auch in Stralsund angehen werden. Die Mitarbeitenden sollen von Anfang an in den Innovationsprozess eingebunden werden und verstehen, was wir produzieren.
Vielen Dank für das Gespräch!

Mark Schneeberger, CTO EAT BEER Biotech GmbH
“Take, make, waste war gestern.”